Corona Chronicles
23–03–2020
Collaboration by Linda Weiß Catharina Szonn Sarah Reva Mohr Philipp Hindahl Sarah Johanna Theurer Haris Giannouras Gunter Reski Nicole Kreckel
Collaboration by Linda Weiß Catharina Szonn Sarah Reva Mohr Philipp Hindahl Sarah Johanna Theurer Haris Giannouras Gunter Reski Nicole Kreckel
For a few days, the most ordinary things in life like meeting for a coffee, or a drink after work, even going for a walk together are now restricted in many European cities. We are alone with ourselves, or together with our partners or kids in small microcosms that are limited by the space of our flats, rooms and Wi-Fi-connections.
Many of our friends and colleagues stay at home. A few of them because they are afraid of being infected, others to flatten the curve, but most of them because their jobs have been cancelled and exhibitions have been postponed. What happens to the people in the cultural world if it suddenly shuts down? What are the pitfalls and can there still be a productive potential within this crisis? PASSE-AVANT asked several friends that are affected by COVID-19 in different ways to share their perspectives. Read their stories.
Commissioned illustrations by Timo Lenzen

Courtesy: Timo Lenzen
#1 Ein Survival-Kit des Miteinanders
Mein Bauch erinnert sich an Freitag: Zapfenstreich. Sonntag stieg die Bedrängnis der Aus- und Eingrenzung bedrohlich die Speiseröhre hoch. E-Mail und andere Kommunikationswege sind seither verstopft von den Nachrichten abgesagter Ausstellungen, Workshops, Vorträge. Überall das gleiche, mutmaßlich. Seit Montag verweilt ein kleines Fläschchen mit grünlichem Desinfektionsgel nicht mehr auf meinem Materialschrein, sondern begleitet mich auf täglichen U- und S-Bahnfahrten. Ich schaue in betretene Gesichter, nicht nur in der Frankfurter Innenstadt, sondern auch, wenn man in den gespenstisch leeren Fluren und Räumen der Universitäten, Ausstellungsräume und Atelierhäuser doch ein menschliches Wesen erblickt. Alles liegt auf Eis, wann und wie ein Auftauprozess funktionieren kann, scheint in Anbetracht des offenen Endes nicht denkbar.
Wie viele meiner Freund*innen bin ich Künstlerin. Wir sind als Absolvent*innen oder jene, die sich am Ende ihres Studiums befinden, die Frischlinge des Kunst- und Kulturbetriebs. Uns ernährt die Zuarbeit und nicht das Herzblut, welches in jede Form und Fläche fließt. Die letzten Tage waren Stillstand und, sobald Gesundheitszustände geklärt werden konnten, futterte sich eine andere Angst leise durch Konversationen – die ökonomische Schockstarre. Niemand möchte mehr seinen Kontostand aufrufen, stattdessen wüste Kalkulationen wie lange Geldreserven wohl ausreichen werden bzw. müssen. Die subtile Frage des Überlebens, welches sich als ein tägliches Gespenst ohnehin aufdrängt, ist zu einem greifbaren Begleiter mutiert.
Nun gibt es neben denen, die dem momentanen Geschehen pessimistisch gegenüberstehen, auch jene, die von einer positiven Entschleunigung sprechen. Zeit zur Einkehr, für die Steuererklärung, oder für die nächste Bewerbung, um die Chance des zukünftigen Ausstellens zu erweitern. Und sicherlich brauchen wir nun viel Mut und Zuversicht um das große Unbekannte zu … erdulden, auszusitzen, überwinden, gar zu bezwingen (?).
Ich möchte an dieser Stelle einen Ausschnitt meiner kleinen, persönlichen Blase teilen. Die letzten Tage begegneten mir Künstler*innen und Kurator*innen, die aus der Krise keinen Überlebenskampf des Ichs machen, sondern mutig das Sorgetragen auch um die Kleinsten praktizieren. Glücklich sind diejenigen von uns, die in ihren Arbeitsstrukturen als Lebewesen agieren können und nicht als ungebrauchte Ressourcen der Wertschöpfungskette eingefroren werden. Es ist nun an der Zeit, dass nicht nur eine gute Besserung gewünscht wird, sondern auch, allen Unterstützung anzubieten, die mit steilen Machtgefällen konfrontiert sind.
Folge ich der derzeitigen Sehnsucht einiger die Situation produktiv nutzen zu wollen, bietet sich wohl jetzt die Chance, Ideen und Utopien der vielen anthropozän-kritischen Ausstellungen, die uns Menschen auf die Sezierbank legen, aus den geschlossenen Räumen zu befreien und hin auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen. Wir benannten Gefahren und Krisen von rein menschlichen Verhältnissen, bspw. politisch-destruktiven Strömungen, oder aber von spezies-übergreifenden Beziehungen, wie in Diskussionen um die Rettung von Lebensräumen.
Wir als Künstler*innen sollten uns fragen, was es heißt und wie es gelingen kann, diese Überzeugungen über die Materialisierung des Kunstobjektes hinauszutragen, in Lebensrealitäten zu erproben und auf deren Möglichkeiten zu testen.
Vorschlag: Lasst uns das Survival-Kit packen. Wie wäre es als erstes Solidarität und Fürsorge in unseren Carrier Bag[1] einzuladen? Ich hoffe auf ein Für- und Miteinander in allen Mikrobläschen und Makroblasen.
– Lina Weiß
[1] Ursula Le Guin, The Carrier Bag Theory of Fiction, 1986
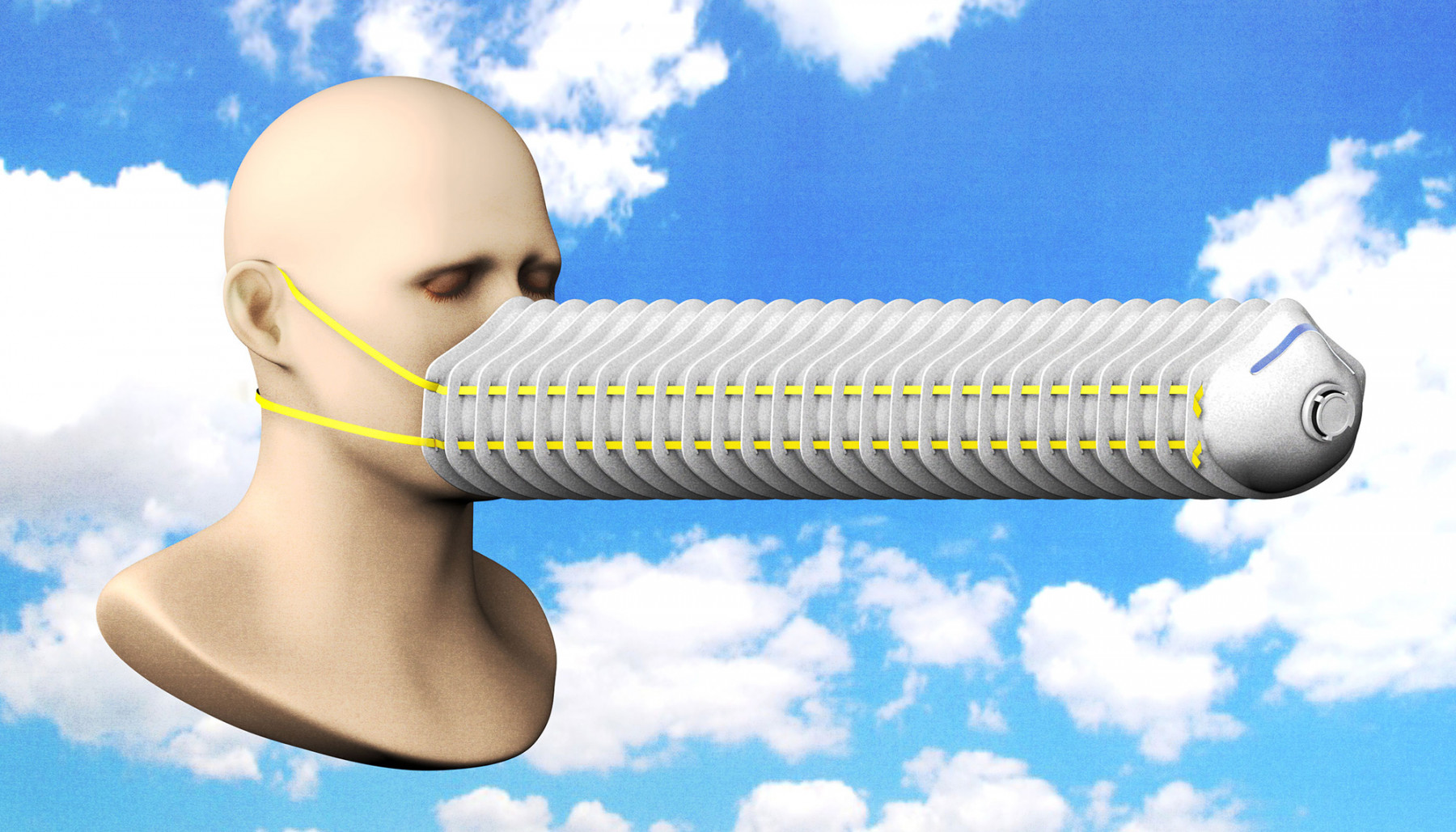
Courtesy: Timo Lenzen
#2 Zukunft war gestern – Willkommen im heute
„Günstig für alle“ lautete vergangene Woche die Werbung bei Penny. Es blieb einem die Freude auf ein Schnäppchen dennoch im Halse stecken, denn gespart wurde erstmal an sozialen Kontakten. Die analoge Realität wird seitdem durch digitale Dienste ersetzt. Verantwortung zeigen, indem man möglichst viel Abstand zueinander hält. Digital wurde abrupt zum Status quo.
Sicherlich gibt es viel dazu zu gewinnen und man kann genügend neue Ideen ausprobieren, mit denen man sich freiwillig oder unfreiwillig mehr an den digitalen Raum klammert. Biertrinken mit Freunden via Skype, Theateraufführungen mittels Stream oder Kurator*innenführungen online – ein Zugeständnis zum Ersatz. Die vermeintliche Chance der Entschleunigung wird durch ein Kompensationsprogramm substituiert. Als hätte man die anfängliche Panik überblenden können und die Aussicht auf mehrere Wochen in Isolation digital weglächeln wollen – mit Archivmaterial oder Online-Rundgängen durch Ausstellungen, die man vermutlich nicht mehr zu Gesicht bekommen wird.
But who knows – die Zukunft steht in den Sternen. Es ist nun die Challenge aus dem Ramschtisch die Qualitätsmarke zu ziehen. Wie werden Institutionen und Künstler*innen die nächsten Wochen mit der Konzeption ins Ungewisse umgehen? Und was sind genau die Chancen der Transformation über die spekuliert wird?
Der Soziologe Heinz Bude schließt nicht aus, dass sich die Ära des Neoliberalismus und somit die Ära des starken Einzelnen wandeln wird. Naheliegend erscheint auch der Titel der Veranstaltung „Die große Untergangs-Show – Festival Genialer Dilletanten“ von 1981 im Berliner Tempodrom. Möglichst wenig können und darin etwas Neues hervorbringen, sollte vielleicht doch anders aussehen, als sich selbst mit inhaltlichen Schräglagen online aktuell zu halten. Verweigerung hat an Bedeutung verloren. Muss man jetzt auch nicht zwingend sentimental werden.
Institutionen und Künstler*innen waren auch vor dem jetzigen vorübergehenden Realitätsaus mit Online-Formaten sichtbar. Ob sich diese digitale Sichtbarkeit verallgemeinernd als ein Muss anstatt einer Option gestaltet, bleibt offen. Man kann sich nicht sicher sein, ob man überhaupt zu dem zurückkommen wird, was vorher gewesen ist. Im Moment fehlt jede Freude über das mögliche Ende, wenn man nicht weiß, ob die Zukunft schon das Ende vom Anfang ist.
Die gesellschaftliche oder persönliche Apokalypse zeigt sich für einige schon jetzt, für andere kann es noch Wochen dauern, vielleicht werden es auch einige wenige unbeschadet überstehen. Homeoffice als Knautschzone – von zu Hause aus weiterhin produktiv sein, in der Hoffnung nach der „Krise“ wieder oder fortlaufend sichtbar zu sein, wie gehabt. Feiert man so den Abgesang des Neoliberalismus, in der Vorahnung den Gürtel zukünftig noch enger zu schnallen? Welche Maßstäbe werden auch im jetzigen kollektivem Knock-Out verfestigt und weitergeführt? Werden diejenigen, die vorher bereits außerhalb von Sichtbarkeit gewesen sind, nun im Zuge der Chance auf Transformation des Ausnahmezustands mitgedacht?
In der Fußball-Bundesliga (Herren) kündigen Vereine an auf Gehälter der Spieler ganz oder teilweise zu verzichten, um so dem möglichen wirtschaftlichen Exitus des Vereins entgegenzuwirken. Wo sind die Topverdiener*innen in der Kunst und wo ist deren Einsatz für Solidarität? Es wäre eine Möglichkeit in dieser Ausnahmesituation das wirtschaftliche Ungleichgewicht anders auszubalancieren, gerade weil alle betroffen sind. Bemühungen um Sichtbarkeit sind gerade groß.
Der Sturz aus dem gewohnten Fahrwasser kam überraschend und in diesem liegt ja auch das vermeintliche Potenzial. Nun machen Institutionen mit ihrem Krisen-Onlineauftakt all das zugänglich, was tendenziell sichtbar gewesen wäre. Warum sollte man auch den Kopf in den Sand stecken, denn damit ist auch nichts gewonnen. Nur welche Inhalte weichem dem Wettbewerb um digitale Sichtbarkeit, den man sich auch erstmal leisten können muss.
Der digitale Trost hilft einem auch nur so lange über die optischen Runden bis man bemerkt, dass das, was sich als digitaler Vorrat abzubilden scheint genau der Punkt ist, an dem wir zuvor angelangt gewesen sind. Kanonisierung – und seine Hinterfragung. Und nun gehen wir mühelos dazu über den selben Kanon als Notlösung für abhanden gekommene Realität zu zeigen.
In der Ratlosigkeit der Situation und der Hoffnung, die keinen wirklichen Gegenstand trägt, besteht eigentlich auch kein Grund in nostalgische Gedanken zu verfallen, weil man der Zukunft pessimistisch entgegenblickt. Es bleibt abzuwarten, ob ein „Günstig für alle“ nicht doch ein „Günstig für wenige“ ist.
– Catharina Szonn
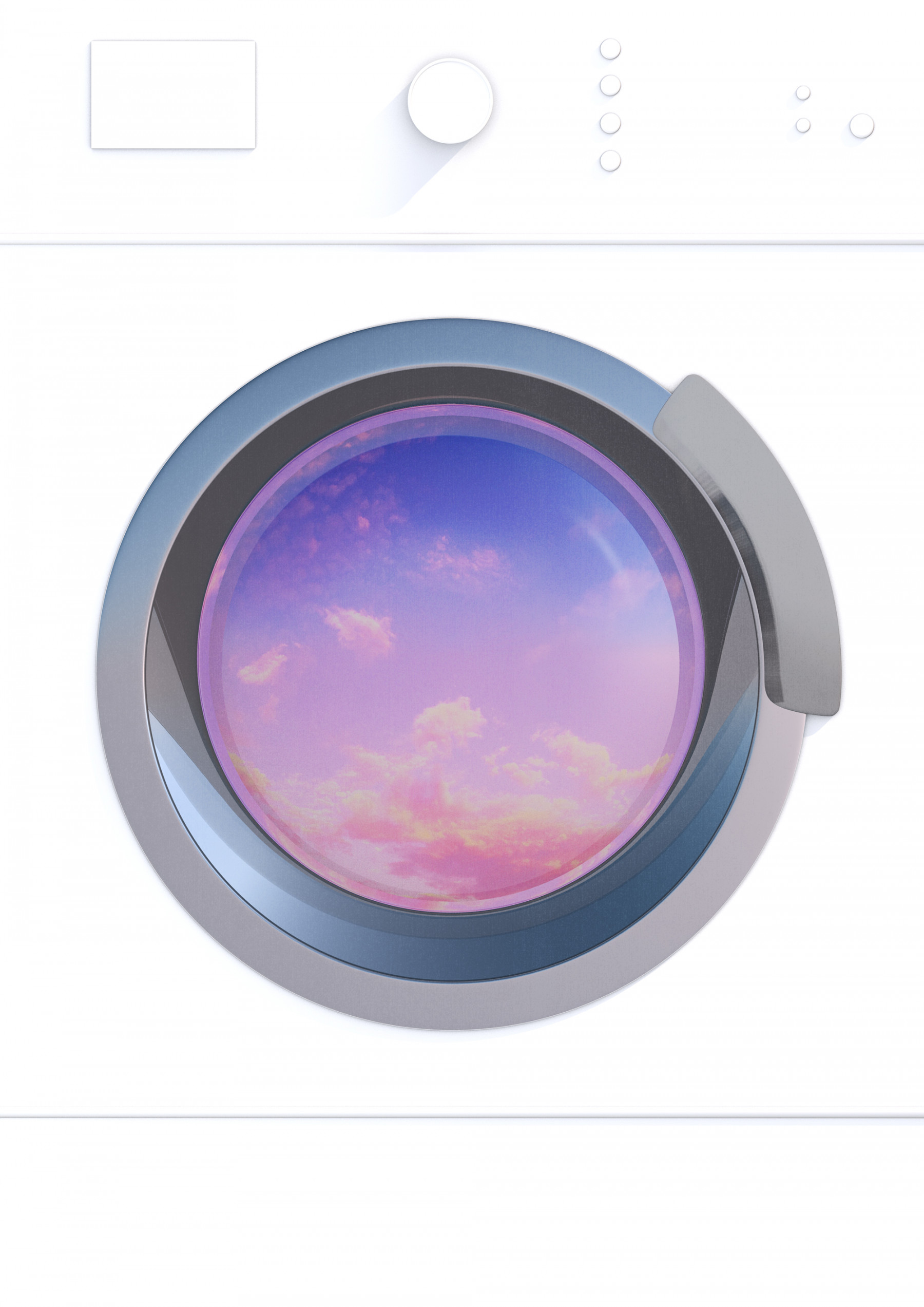
Courtesy: Timo Lenzen
#3 See you in the afterlife
It’s quieter than usually at the laundry service. Some drums are spinning, but at different speeds. Besides me, only an old man is waiting here. He sits on one end of the bench, I sit on the other. I would not pay to much attention to this fact under any other circumstances if it wasn’t now. My eye unconsciously measures the approximate distance between us. I’d say about two metres. But I’m not sure. Outside, at the entrance of the laundry service, it says, “Now open on Sundays”. In fact, the whole week already feels like an incessant Sunday. The reporting as well as the pictures on the Internet with curated scenarios of empty streets and abandoned squares do the rest. I spend my time waiting with Annie Ernaux’s The Years (2017). Philosopher Didier Eribon writes about the book: “A life-changing reading”.
Different sense of space and time
Different sense of space and time
Will this time be an equally “life-changing” experience for artists? Since we live in parallel worlds anyway, it must made clear that in many places art can no longer be separated from politics – unless we want to carry on like this. Rushing from one deadline to the next – how normal it seemed to take certain mechanisms of exploitation for granted up until now. The phase we are currently in – commonly referred to as the ‘crisis’ – is actually only the culmination of a state of affairs that we considered normal for a long time. On the one hand, everything is on standby – time for activities that would have remained undone otherwise, distraction and participation welcome us everywhere, so we don’t feel lonely. Reading-groups and book recommendations are flooding digital spaces. On the other hand, things have to go on, thoughts are already circling around the time “afterwards”: What happens after this and, above all, when? Will the savings last until then? Can I take up my jobs again? Will exhibitions still take place? Will everything go its usual course, like after waking up from an extended hibernation?
Outside the magnifying glass
What is productivity and what does “taking a break” actually mean? Does the whole distraction and participation reflect our inability to drop anything, fearing that creativity will vanish and opportunities will be missed? If not now, when else will we become aware of the mechanisms of being seen, of participating in the so-called attention economy? There’s nothing more important for the production of art right now than thinking about how community should look like in the future. Time for criticism and self-criticism: Do I want to maintain the pace or can I act more humane, not economic/marketable?
At the moment, one’s own network might be able to save oneself – self-sufficient art projects, off-spaces and small galleries as well as art associations are practicing flexibility in terms of deadlines and digital formats. Latter can be published at any time and in an institutionally independent manner. It’s exciting to watch and to be involved in things that are improvised and newly developed without knowing how long this state will last (it will probably reach a saturation point soon). In a field like art, which is usually driven by far too little solidarity and cooperation, there is now a great willingness to support each other and to develop strategies to give visibility to those who might otherwise disappear (or remain invisible at all): artists feature each other, archives are gaining new popularity and the access to artworks that are otherwise spatially defined and reserved for specific target groups is becoming more low-threshold. Does this mean that exhibitions are now being democratized? To what extent can the social relevance of art be discussed in times like these? Will the increasing digital presence on social media be enough to compensate for the loss of visibility? It seems like a lot of effort is unquestioningly put into online formats at the moment – requiring non-profit work/labour one would usually be paid for. The “after” is becoming more and more pressing in our minds.
It is precisely the moment between “now” and “then” that this inventiveness must form a bridge, especially for the post-pandemic period. The voices that fight for universal basic income are getting louder again – but not in the form of a temporary solution to the shortfalls, but as a permanent structure. Governmental support payments must not be a bridging measure but should be improved permanently.
In case you start to feel something like spatial anxiety and before you devote yourself to your own quarantine of thoughts, think of others: In too many places a large number of people cannot stay in closed private rooms – because there are simply none. In addition to coping with our own problems and challenges, we should not lose sight of the more precarious situation of others. I wish that the extent our ability to improvise in solidarity is not limited to our own fields of activity.
In case you start to feel something like spatial anxiety and before you devote yourself to your own quarantine of thoughts, think of others: In too many places a large number of people cannot stay in closed private rooms – because there are simply none. In addition to coping with our own problems and challenges, we should not lose sight of the more precarious situation of others. I wish that the extent our ability to improvise in solidarity is not limited to our own fields of activity.
Annie Ernaux writes: “Now is another time.”
– Sarah Reva Mohr
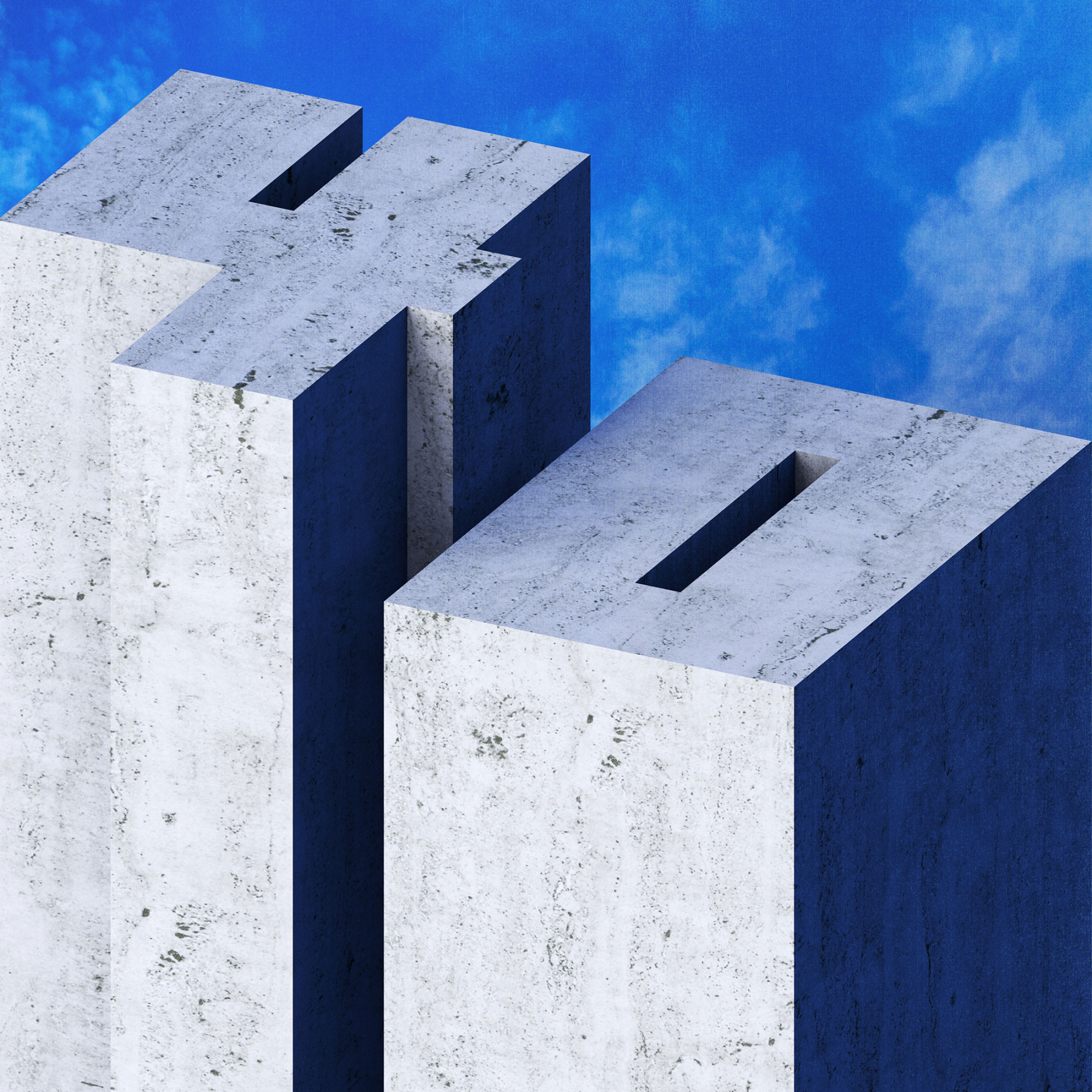
Courtesy: Timo Lenzen
#4 40 Days, 40 Nights
As I went to the park with my friend to escape the doomsday content of my social media feeds, we debated the merits of living in small tenement houses versus big tower blocks. She said, it was alienating to live far from the ground, as we walked past housing buildings designed by Helmut Stingl. Between little lakes, playgrounds and groves, the 1980s apartment blocks are loosely grouped – concrete covered witnesses to the years when the GDR was already in decline. The sun was shining. Children cycled, grown-ups went for their afternoon runs. Given that the city is under lockdown it was surprisingly crowded. It was lively and noisy, nothing hinted at a crisis.
The higher the better, I said and hastened to admit that my desire to live so remotely yet in the centre of a city is childish, as we reached a pond in the park in East Berlin. The idea of staying tucked away, hidden, enclosed is so comforting, I said. Like a house cat that inadvertently gravitates towards boxes, enclosures, niches. As a child I would be most interested in places to hide, and I had a strange fascination for secret passages and receptacles. We are all supposed to be enclosed now, that is if we are privileged enough to have a personal space to quarantine in.
Isn’t it strange how quarantine has become a verb, like hibernate, as if it was an activity? It recalls the number forty, quaranta in Italian, the very finite amount of time that ships had to remain anchored outside the city of Venice before docking in the lagoon. Then, people did not know about microbes, but rather imagined the Black Death to be caused by foul vapours. It was also the time span, the city of Florence spent in full lockdown in January of 1631. A plague epidemic raged in Northern Italy, a time when for most the world stood still, as Erin Maglaque observed in her recent essay for the London Review of Books.1 This moment denotes an intermediate stage, the appropriate time to be tucked away from the world, except, that the 17th century epidemic ushered in the economic downfall of the once prosperous city.
The forty days are justified by an age when time was viewed as cyclical. I think of my years in Catholic school when I was made to read the Bible, and forty seemed to be an interval ingrained in all kinds of earthly and transcendental proceedings. “(…) I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth,” said God to Noah in Genesis 7:4. Christ remained in the desert for the same period, fasting, until the Devil tempted him (Matthew 4:2), after he was resurrected from the dead, he remained on earth for forty days (Acts 1:3). Lent, which ends with Easter, lasts forty days. All these periods mark a transition from one age to another and they reoccur with a calming regularity throughout the Bible. Forty is ten times four, which is two times two, and in this symmetry lies some beauty. Forty: have no fear, the number whispers, the crisis will be over soon. The world is in order, it is paused only for a while.
Except, quarantine now seems open-ended. I recently reread Rainald Goetz’s poetry collection Das Jahrzehnt der schönen Frauen (The Decade of Beautiful Women, 2001). I like to revisit it sometimes. The poems circle around the word KRANK, sick, in all caps. The writer composed them in the last days of the 20th century and they encapsulate his trademark zany, anxious, diaristic style. Their Y2K paranoia still seems weirdly timely. “Die Wahrheit ist schütter / und wer friert und sich fürchtet / vor Weihnachten heißt / KRANK,“ (The truth is scanty / and those who are cold and afraid / before Christmas are called / SICK) Goetz wrote, while he was hospitalised in East Berlin.
In the two decades that have passed, the sentiment of crisis has never left. The housing market collapsed, the art economy blew up like sourdough, and the turmoil never seemed finite. No one called out the economy’s illness, it seemed only prolonged by government bailouts, by the refusal to seriously question neoliberalism and austerity measures. Unlike the widely told stories of past crises, the corona crisis is drawn out and strangely anticlimactic, and it doesn’t feel like a story. It feels like a very boring apocalypse, my friend says, as we pass a playground in our park.
– Philipp Hindahl
[1] Cf. Erin Maglaque, Inclined to Putrefaction, 2020, London Review of Books,

Courtesy: Timo Lenzen
#5 Half-Life
A few weeks ago, society splintered into nuclear households and we were all forced to engage intimately with immersive technologies. I have always lived in a technologically saturated world, but now I rely even more on prosthetic devices to maintain ever more distant social relations.
While standing in the kitchen whipping the batter for my banana bread, I recognize this is what economists call ‘path dependence’: The more time I invest in technologies, the more I depend on them. Repetitive use creates a habit, which means that soon I will no longer be able to examine the premises of these habits. We now have to acknowledge the digitalization of intimacy, and we have to trust platforms and companies to respect our privacy. Trust is a crucial issue in times of social atomization – and trust plays a crucial role in engaging with immersive technologies.
In the 1950s, telepresence was envisioned as a vehicle leading us into a remote-controlled economy inspired by science fiction. I still enjoy its ‘pre-set’ in Robert A. Heinlein’s short story Waldo (1942) more than the actual experience of telepresence when entering daily zoom meetings or trying to facetime my mom. These moments rarely provide such comprehensive and convincing stimuli like a good story I can immerse myself in.
It is hard to suspend disbelief when I click through the overwhelming amount of virtual museum tours. The reason why I look at these is because soon enough, I will have to implement some version of them in my work as well. I come to think the plausibility and space illusion are quite accurate. The museums look like video games, but without the fights and the rewards.
The only thing that sticks with me is the scary ambience, which I also feel during my early evening strolls through the neighbourhood. I step out after popping the silicon vessel with the banana slush in the oven. The block outside is deserted and resembles a poorly designed area of Half-Life’s ‘City 17’. When the first Half-Life game was released in 1998, it was a breakthrough in immersive gaming. Since then, many episodic extensions and mods have been released and Half-Life is considered one of the most influential first-person shooters. I read all of their stories when I get back home.
The prequel Half-Life: Alyx is a VR-game and was released just in time for the lockdown in Europe. Within the game I venture into the quarantine zone of ‘City 17’. The city’s distinctive architecture is the perfect amalgam of urban decay: abandoned structures with Neoclassical features – possibly dating from pre-World War II – intersected by post-war classical design revivals, graffiti on Soviet Modernism and contemporary buildings with massive jumbotrons. Police are patrolling the streets and people are under surveillance by drones. These days, the boundaries of Half-Life and my own life are easily trespassed.
I return to my building complex and press the elevator button with a key to avoid touching any of the presumably contaminated materials around me. This feels like William Rees-Mogg’s Sovereign Individual is becoming reality. I guess it’s not a bad story if you are into survival horror. The book was published in 1997, one year before the launch of the first Half-Life video game. It contains some pioneering predictions about cryptocurrencies, electronic warfare, smartphones and online bots imitating humans. And it drafts opportunities for disaster capitalism and super-elitism that come with it.
Rees-Mogg borrows quite a bit from game theory which has its philosophical origins in texts about combat strategy: in classic game theory, man is always at war with everyone.
From this perspective, society itself is nothing but a burden. I picture myself in the ascending elevator preparing to encounter a neighbour on the next floor. Could I be this ‘sovereign individual’ breaking free from its dependence on others? An ego-shooter who can dispense solidarity?
The point is, I need to be in some kind of story. Immersion and verisimilitude will always be a moving threshold. Now that my life is only half a life, it has become easier to create continuity between the physical and the virtual realities. My life has always been driven by gamified motivation triggers. This may be complacent, but I find resilience in the game. I am simply not willing to give in to the despair of a collapsing world. I switch realities.
– Sarah Johanna Theurer

Courtesy: Timo Lenzen
#6 Escapism
Streaming blockbusters for free and hunting down the stars that flow from the place, where the Big Dipper used to be, all the way down to the centre of the West German city of __ has become the new behavioral norm for battling seasonal depression. Forcing the global population into solitary confinement in times of urgency is a governmental power move that is hard to argue against. If it’s meant to help the collective and save lives, it reads as an important measure embedded in the aura of an ‘act of god’. Nonetheless, the abuse of power on which capitalist economies thrive is bound to make an appearance. For social beasts that need to live in close proximity to one another, the prospect of daydreaming is all the more relevant while separated.
The white bookshelf opposite the old grey couch grows in four shelves. The first includes paperwork and taxes for when the day comes to rage against the machine. The second is framed by two plants and carries a selection of German, English, and Greek books. The third holds a movie projector that has been purchased online a couple months prior. The fourth is not easily accessible because it remains hidden behind a veil of the same smoke and debris that has been roaming the galaxy since the end of the so-called ‘conflict period’ that shook the early 00s. On the wall to the right of the white-trimmed shelf hangs a round wooden mirror. For the wondrous little people living and thriving behind the smokescreen, the mirror represented a lost utopia of mythic proportions, a golden shiny starlight they looked up to from their tiny colonial-style homes spread across the entire east valley of the top shelf all the way to the west side of the bookcase. The mirror reflected its opposite white wall, which made the sky appear brighter than it actually was. The tiny people of the fourth shelf were thought to be extinct long before the lockdown began. Their microcosm is a prime example of a self-sufficient green economy that thrives in the climate of the living room. Their main activities included agriculture and fracking and their primary source of wealth came from trade with the different tribes living between the potted plants of the street-facing windowsill and the bureaucrats of the northern stars. Religion-wise, the majority of them seemed to identify with an atheist sect and had a strong inclination toward pacifism and eco-pornography. They went to church, did their groceries, watched television, and argued about food delivery options. All in all, they made for an enticing closed-circuit network of communicators that would fascinate even the most irrelevant explorers.
Yet, what seems to enchant explorers and colonialists from across all the civil nations of the apartment is the cloud’s voluminous power, which is something they feared greatly for many years now. Rarely seen indoors and mostly spotted in the outside realm, cloud formations could fetch high prices on the black market, with some selling for hundreds of thousands of Euros. Describing these clouds is a particularly difficult endeavor, an added element of interest. They rarely stay the same and tend to transform into new and unexpected shapes depending on the temperature, one’s point of view, as well as the common logistics regarding their weekly itineraries (whether they move up and down or left and right). The origins of clouds and the one hovering over the fourth shelf in particular vary depending on the source. The oldest documented cases date back to ancient western-centric history in the mythological conception of figures such as Eos (Ηώς) and weather descriptions found throughout Homer’s epics. Euripides reported a darker origin of clouds, describing themas clouds of death, worries, and concerns that become visible on the top part of a person’s eyebrows (νέφος ὀφρύων).
The cloud on the fourth shelf often changed colours. Some days, it went from warm tones of green to dusty parts hidden in orange. On others, it shifted from pale-looking blue construction workers to pink-cheeked blushing brides and funeral home janitors dressed in black. The cloud’s body moved between frothiness and the boiling point of no return. He was once able to flow through everything and everyone like a wetland that merges its parts into one, but now he seemed all the more solid day by day.
The curious-looking cloud breathing on the fourth shelf in the living room across from the grey couch became ever more magical as the days passed. Hiscorners scratched the darkened sky causing it to slowly bleed all over the wooden floors. Once the windows are allowed to be opened again, the cloud will most likely stop providing the little people on the shelf the protection they need in order to conceal their homes from the piercing eyes gazing in. Colonialists and venture capitalists from throughout the apartment, including the black and white kitchen tile kingdom and the narrow seas of the bathroom as well as the freedom fighters of the bedroom and the gatekeepers of the backdoor all yearned to uncover the mysteries of an age clinging to its past.
He mumbled and screamed as he felt the end approaching. Scary adventures hardly ever end gracefully, at least according to the conventional norm and language of fiction. Some have to lose while others are obligated to win.
With my fingers stained pink and cut all over, I crack open a window. Pink droplets spill onto the windowsill and make their way down to the dirty sidewalk below. Holding his breath, the cloud rushes outside, abandoning the fourth shelf and its little people to the mercy of what is to come. He falls down and hits the pavement. Mixed with the tones and textures of black and gray, his waters become more visible to the naked eye. Dragging whatever is left of him, he basks in the sun and grins at the sight of people rushing by. The feeling of warmth tingles his skin.
Curious creatures those living room clouds.
– Haris Giannouras
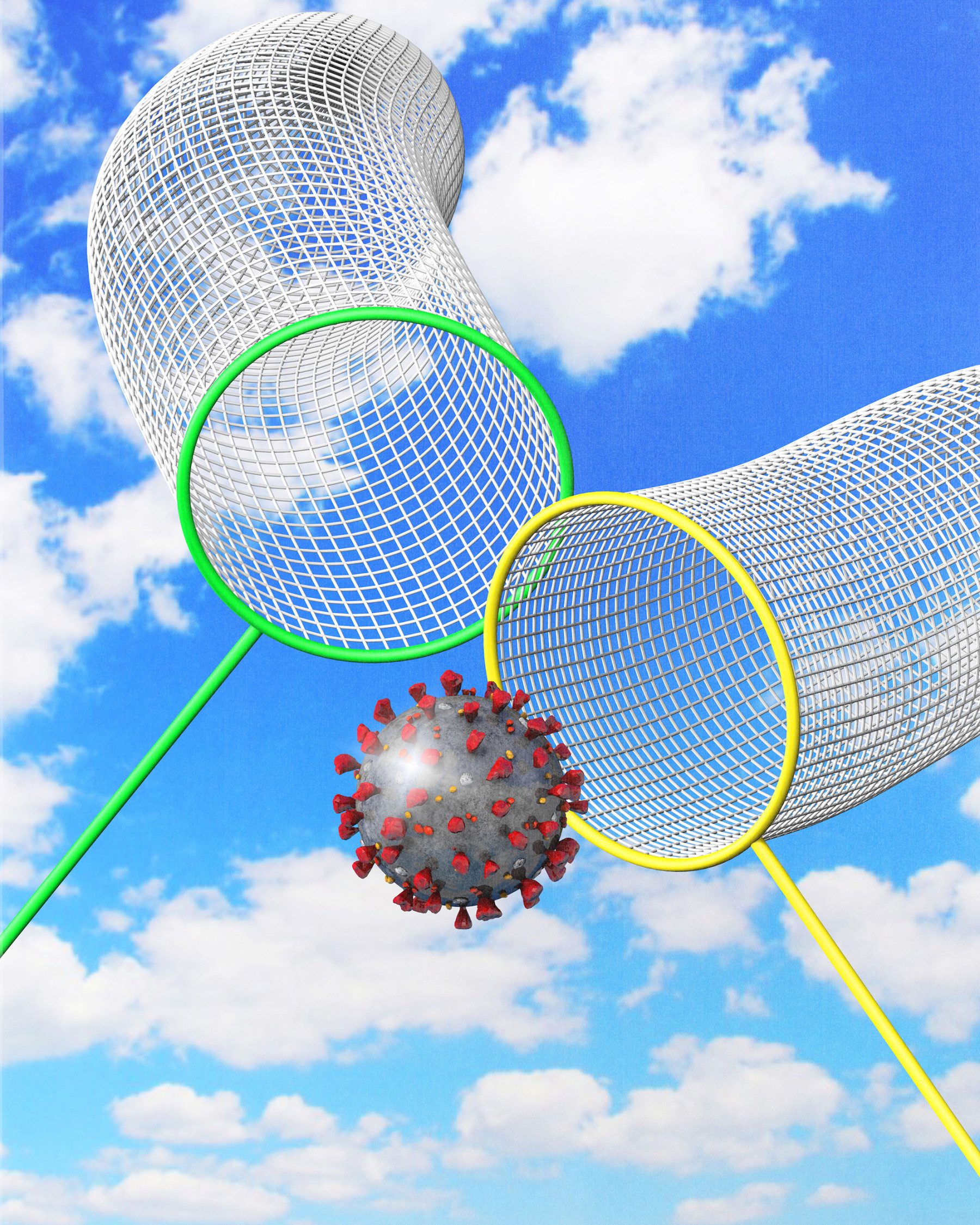
Courtesy: Timo Lenzen
#7 Zum Erwartungsmanagement meiner herbeieilenden Hintergrundimmunität
Die Kaffeemaschine klingt nicht wie sonst nach gurgelndem Mundwasser. Eher röchelnd aus Atemnot. Doch Risikogruppe? Noch keine geruchsfreie Schnappatmung. Seit Mitte März steht ein Stück Harzer Käse als Symptomtester auf dem Küchentisch. Kann man gefühltes Alter geltend machen für eine Pneumokokken-Impfung? Knapp fünfzehn Jahren früher entsprach mein mutmaßlicher Körperfettanteil dem eines Dreißigjährigen. Ich stand fast stolz auf dieser Zauberwaage im Gym für frische Zweijahresvertragsopfer, die es bei einem einmaligen Besuch der Sportstätte belassen werden. Und heimlich beschämt genau in diesem Moment davon wissen. Vom meinem Muskelanteil freundlicherweise kein Ton. Eine interessante Zielgruppe, wenn die Einweg-Besucher sich alle mal treffen könnten. Dann wohl erst im nächsten Jahr. Alle mit viel verstaubter Scham auf den Schultern. Ein Besuch für knapp 2000 Euro. In acht Wochen drei Masken genäht, die alle an den Ohren zwicken. Zuerst angenehmer Beruhigungsaktionismus. Die größte Muskelverdichtung ist im Gesicht platziert.
Die Kaffeemaschine klingt nicht wie sonst nach gurgelndem Mundwasser. Eher röchelnd aus Atemnot. Doch Risikogruppe? Noch keine geruchsfreie Schnappatmung. Seit Mitte März steht ein Stück Harzer Käse als Symptomtester auf dem Küchentisch. Kann man gefühltes Alter geltend machen für eine Pneumokokken-Impfung? Knapp fünfzehn Jahren früher entsprach mein mutmaßlicher Körperfettanteil dem eines Dreißigjährigen. Ich stand fast stolz auf dieser Zauberwaage im Gym für frische Zweijahresvertragsopfer, die es bei einem einmaligen Besuch der Sportstätte belassen werden. Und heimlich beschämt genau in diesem Moment davon wissen. Vom meinem Muskelanteil freundlicherweise kein Ton. Eine interessante Zielgruppe, wenn die Einweg-Besucher sich alle mal treffen könnten. Dann wohl erst im nächsten Jahr. Alle mit viel verstaubter Scham auf den Schultern. Ein Besuch für knapp 2000 Euro. In acht Wochen drei Masken genäht, die alle an den Ohren zwicken. Zuerst angenehmer Beruhigungsaktionismus. Die größte Muskelverdichtung ist im Gesicht platziert.
In den verflossenen Häusern warten auch Worte. Jetzt nichts mit Tropfen oder Tränen. Stehen plötzlich Posten am Fenster oder im Flur. Meine Freundin wird angebarscht, was sie hier in diesem Haus zu suchen hätte. Ich entwerfe einen Blockwartorden und werfe ihn mutig der Nachbarin in den Briefkasten. Ziemlich groß geworden. Wird heute schwierig mit ihrer Postzustellung. So wie man nicht gekündigt werden kann, netterweise, kann man vielleicht selbst ebenso nicht kündigen? Bis der Impfstoff da ist. Bis die zweite Welle kommt, habe ich wieder was aufzuräumen. Ich trage in der schleichend normalisierten Normalisierung einige Kistchen mit Kreiden und Pumpstiften in den anderen Raum. Nicht mit Details geizen, die anderen Haushalten fremd sind. Ein altes fast fertiges Bild im Raum schaut mich immer noch nicht krisenverjüngt an. Deine Falten kriege ich auch noch weg. Jetzt nichts mit Spiegelbild. Zwischenzeitlich war eine gemutmaßte Übervorsicht einiger Regierungen auf einem guten Weg den Kapitalismus zu besiegen. Wenn auch eher als unbeabsichtigter Kollateralschaden. Tolle Regierung, bis Schäuble an den Grundrechten ruckeln will. Große historische Momente stolpern gern über die Unwissenheit seiner Überbringer durch die Tür. Siehe Schabowski, als er selbst ahnungslos die Grenzöffnung in Berlin verkündete. Altersweisheit gegen neoliberal globalen Turbokapitalismus, der zu Lasten von mindestens 80 Prozent aller Beteiligten geht. Wenn man einfach alle über achtzig fragen würde, wäre das sicher interessanter als die Statements aller Vorstandschefs von Lufthansa bis VW.
Und nichts mit Abwrackprämie. Sonst komische neue Freunde aus der Beschwörungsopferecke. Welche Sätze man seit zwei Monaten nicht mehr schreibt, die in den Zimmern warten. Wie kann man bloß dem perma-präsenten Stammtisch eines ewig hyperventilierenden Alarmismus den Stecker ziehen? Immer noch nichts über weltweit verbotene Algorithmen. Atemnebel statt Räuspertröpfchen als Infektionswaffe.
Um die Abstandsregelungen auch nach zwölf Monaten flächendeckend durchzusetzen, werden vermehrt Drohnen mit Wärmekameras eingesetzt. Bei Unterschreitung des Mindestabstands ertönen hochfrequente Töne, die sich bei Bedarf algorhythmisch mit benachbarten Drohnen abstimmen. Klingt wie körperbedingter Freejazz. Der Himmel verdunkelt sich an einigen Stellen. Die Drohnen, alle in hochreflektierendem Alpinaweiß gehüllt, aber bis ihre Menge die weggeschmolzenen Polkappen ersetzen kann, das wird nichts. Gestern war ich in einem Restaurant und es wird Essen von glücklichen Kellnern an den Tisch gebracht. Vereinzelt Passanten, eingewickelt in unzählige Rollen Klopapier beim Freudentanz.
Um die Abstandsregelungen auch nach zwölf Monaten flächendeckend durchzusetzen, werden vermehrt Drohnen mit Wärmekameras eingesetzt. Bei Unterschreitung des Mindestabstands ertönen hochfrequente Töne, die sich bei Bedarf algorhythmisch mit benachbarten Drohnen abstimmen. Klingt wie körperbedingter Freejazz. Der Himmel verdunkelt sich an einigen Stellen. Die Drohnen, alle in hochreflektierendem Alpinaweiß gehüllt, aber bis ihre Menge die weggeschmolzenen Polkappen ersetzen kann, das wird nichts. Gestern war ich in einem Restaurant und es wird Essen von glücklichen Kellnern an den Tisch gebracht. Vereinzelt Passanten, eingewickelt in unzählige Rollen Klopapier beim Freudentanz.
– Gunter Reski

Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, The Soil Map (detail), from 'Terra Forma, manuel de cartographies potentielles', 2019. Courtesy and ©: the artists
#8 Von Zoom-Meetings, YouTube-Führungen und der (digitalen) Ausstellung 'Critical Zones'
So viel Kontakt mit Freund*innen aus London, Würzburg, Hamburg oder Freiburg hatte ich selten. Da auf meinem Laptop inzwischen sieben verschiedene Video-Telefonie-Apps installiert sind, besteht kurz zuvor immer die Qual der Wahl: Bei wem bezahle ich mit welchen Daten und wie gut, sicher, oder flüssig soll die Übertragung des Gesprächs verlaufen?
Kolleg*innen, Freund*innen und Familie sind durch Videogespräche zwar sichtbar – aber ihnen scheint die „Aura“ zu fehlen, es gibt kein körperliches Gegenüber. Mit wenigen Ausnahmen werden aus Dialogen oft aneinandergereihte Monologe – diese erfordern mehr Konzentration, Geduld und Interesse an dem was der/die andere zu sagen hat.
Wie sehr wir auf Technisches angewiesen sind, wird somit in Zeiten der Corona-Isolation besonders deutlich. Die direkte Vernetzung von menschlichen und nicht-menschlichen, hier technischen Entitäten, ist ein Gedanke des 'Neuen Materialismus'. Dieser ist zwar ein sehr diverses Forschungsfeld, jedoch geht es Theoretiker*innen wie Bruno Latour oder Donna Haraway darum, den Menschen nicht als Zentrum allen Denkens zu definieren, sondern unsere Welt, inklusive aller Entitäten, die sich darin finden lassen und netzartig verbunden zu verstehen.
Denkt man an die Zeit während der Ausgangsbeschränkungen und ihrer Reproduktion (auf dem Computerbildschirm) könnten (Mit-)Mensch und Museums-Objekt1 verglichen werden, denn sie beide waren nur über ihr zweidimensionales, digitales Abbild verfügbar. Den musealen Objekten können wir zwar seit wenigen Wochen wieder persönlich gegenübertreten, die Kunstvermittlung hingegen verbleibt großteils noch im digitalen Raum. Die Online-Vermittlung in Zeiten der Corona-Krise lässt sich, in weiten Teilen, mit dem Kodak-Werbeslogan „You press the button, we do the rest“ beschreiben. Es fehlt die Interaktion (als zweibahniger Prozess) mit den Kunstwerken, den Vermittler*innen und anderen Besucher*innen. In bereitgestellten Online-Sammlungen, gerenderten 3D-Museumsbauten, oder YouTube-Führungen ist der Dreh- und Angelpunkt die Reproduktion der „örtlichen“, musealen Erfahrung. Der Rezipient erfährt zwar etwas über ein Museum und seine Objekte, jedoch bleibt der Kommunikationsweg meist einbahnig: Informationen werden übertragen, aber eine produktive und kritische Diskussion der Inhalte bleibt aus.
Dennoch wurde die YouTube-Führung von vielen Museen aufgegriffen. Aber was sind hier die Vorteile? Man beruft sich auf ein bekanntes Format, das dem ersten Anschein nach einfach in den digitalen Raum übersetzt werden kann; die Kosten sind gering und die Abrufbarkeit ist simpel und nachhaltig. Die Idee: Die Betrachter*innen sitzen vor ihren Bildschirmen, lassen sich berieseln und lernen etwas über Kunst. Ein Glas Wein einschenken, den Laptop aufklappen, Play drücken und zurücklehnen: „Herzlich willkommen im Museum xy…“.
Fotografie und Video reproduzieren hier zwar, in einigen Aspekten, das Kunstwerk, sowie die musealen Räume, und ein Stück weit auch das klassische Format der Ausstellungsführung, jedoch wird der „educational turn“ – im Sinne einer Aufforderung zum kritischen Denken – kaum mitgedacht. Die Ebene der Repräsentation wird nicht verlassen, auch nicht bezogen auf die Rolle der Vermittler*innen. Denn wenn die Kurator*innen nicht selbst vor die Kamera treten, erwarten sie meist von den Vermittler*innen „die kuratorische Erzählung so genau wie möglich für das Publikum“2 zu reproduzieren. Dies entspricht auch der Erwartungshaltung eines Publikums, das in kurzer Zeit alle relevanten Daten, Zahlen und exklusiven Fun–Facts angereicht bekommen möchte.
Ich will dem Format der YouTube-Führung (u. Ähnlichen) dennoch nicht seine Berechtigung absprechen, sondern folgende Ergänzung beiseite stellen, im Sinne einer kritischen Kunstvermittlung und eines emanzipatorischen Bildungsanspruches. Für die Kunstwissenschaftlerinnen und Vermittlerinnen Beatrice Jaschke, Nora Sternfeld, Carmen Mörsch u.a. lässt sich diese Herangehensweise mit dem “educational turn” im Bereich des Kuratorischen definieren, also mit der Hinwendung zum Edukatorischen, zur Bildung:
„So geht es nicht mehr um Ausstellungen als Orte der Aufstellung von wertvollen Objekten und Darstellung von objektiven Werten, sondern um Handlungsräume des Kuratorischen, in denen ungewöhnliche Begegnungen und diskursive Auseinandersetzungen möglich werden, in denen das Unplanbare wichtiger erscheint als etwa genaue Hängepläne.“3
In diesen Zusammenhang passt die aktuelle Ausstellung ‘Critical Zones‘ im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM), die gemeinsam von Bruno Latour und Peter Weibel, Martin Guinard-Terrin, Bettina Korintenberg und Daria Mille und kuratiert wurde. Der Direktor, Peter Weibel, sprach sich bei der digitalen Ausstellungseröffnung gegen das passive Betrachten von kunsthistorischen Exponaten aus. Die Kurator*innen definieren das begriffliche Netz, in das sich die Ausstellung einordnen lässt als „Gedankenausstellung“ oder eine Art „Think-Tank“ in dem Expert*innen aus verschiedenen Gebieten zusammenarbeiten und -denken. Corona-bedingt startete die Ausstellung zum einen virtuell und zum anderen mit einem bereits aufgebauten Exponat im ZKM, dem Observatorium. Betritt man diese Installation hört man durch eine Tonspur bzw. Hörstation den Strengbach plätschern. In Zusammenarbeit mit der Geochemikerin Marie-Claire Pierret entwickelten die Architekturhistorikerin Alexandra Arènes und der Architekt Soheil Hajmirbaba eine raumgreifende Installation und Narration auf Basis des geologischen Profils des Freilichtlabors Strengbach. Umweltforschung, deren visualisierte Datenflüsse und der Mensch als Teil dieses Netzwerkes werden thematisiert.
Objekte und Daten, also Nicht-Menschliches und Menschliches sollen in zweibahnige Interaktion treten – wie ebenso durch eine Beschreibung auf der virtuellen Plattform zur Ausstellung deutlich wird:
„[...]Kunstwerke, Archivmaterialien, Texte, Handlungsanweisungen und Ereignisse sind Entitäten – genau wie Sie und Ihre BegleiterInnen, die anderen BesucherInnen. Zusammen reagieren alle Entitäten aufeinander und interagieren miteinander, wodurch ein generativer Raum entsteht, der sich ständig neu zusammensetzt.“4
Das Sich-Berieseln-Lassen ist beim Durchstreifen der digitalen Ausstellung nicht möglich, denn bei jedem Aufruf verändert sich die Plattform und den Besucher*innen springen, ergänzend zur Kunst- und Forschungsvermittlung, Einladungen (wie diese) ins Auge: „Konzentriere dich für einen Moment auf deine Körperhaltung. Finde eine neue Position.“
Vermittlung und Kuratorisches greifen in dieser „Gedankenausstellung“ verschränkend ineinander und die Besucher*innen-Erfahrungen können von politischem Nachdenken, einem gewöhnlichen Ausstellungsbesuch bis hin zum Field-Trip reichen. Während des Betretens der digitalen Plattform ist man sich seiner selbst stets bewusst: dem körperlichen Raum, den man einnimmt, und seiner Gedanken, denn man wird dazu aufgefordert die eigenen Gedanken zu überdenken.
In diesem Sinne verstehe ich ein „Best-Practice“-Beispiel der digitalen Kunstvermittlung: in der visuellen Darstellung thematisiert die Plattform die Vielschichtigkeit der Ausstellungsthemen und weckt gleichsam die Neugierde der Besucher*innen auf eine kritische Auseinandersetzung mit künstlerischen Positionen und im Grunde auch mit der eigenen strukturellen Wahrnehmung der Welt.
– Nicole Kreckel
1 vgl.: Sternfeld, Nora: Der Objekt-Effekt, S. 27, aus: Gegen den Stand der Dinge, hrsg. v. Martina Griesser u. a., De Gruyter Berlin 2016.
2 Carmen Mörsch: Sich selbst widersprechen. Kunstvermittlung als kritische Praxis innerhalb des educational turn in curating, in: Ausstellungstheorie & Praxis Band 5: educational turn. Handlungsräume der Kunst- und Kulturvermittlung, hrsg. v. Schnittpunkt, Beatrice Jaschke, Nora Sternfeld, Verlag Turia + Kant Wien, 2012: S. 55.
3 Jaschke/Sternfeld 2012: S. 15.
4 Digitale Plattform der Ausstellung „Critical Zones": https://critical-zones.zkm.de/#!/ (zuletzt aufgerufen: 26.05.20).